#Metoo im Tanz – es war nur eine Frage der Zeit, bis die in der glamourösen Welt des US-Films losgetretene Sexismus-Debatte auf die deutsche Tanzbühne schwappen würde. Vielerorts wird seitdem in den Compagnien und Tanzszenen über Gefahren sexuellen Missbrauchs am Arbeitsplatz debattiert; im Fall konkreter Verdachtsmomente, wie an der Semperoper in Dresden, wird gehandelt. Auch Tarek Assam, Sprecher der Ballett- und Tanztheaterdirektoren Konferenz, berichtete unlängst, dass sein Gremium das Thema aufgreife und aktiv werde, sobald konkreter Handlungsbedarf bestehe.
Ist das genug? – Nein, wenn es darum geht, dass Theater und Compagnien so weit wie möglich und nötig darin unterstützt werden, das Bewusstsein für würdevolle Zusammenarbeit zu fördern. Dennoch tut die Hitze, mit der im Zuge von „#Metoo“ die Gender-Debatte im Tanz wieder hochgekocht wird, weder der Sparte noch dem Berufsbild gut. Im Gegenteil. Der Tanzwelt im Zuge der publik gewordenen und teil entkräfteten Vorfälle in den USA und Frankreich eine erhöhte Anfälligkeit für sexuellen Missbrauch zu unterstellen, scheint absurd. Dafür sprechen weder Zahlen noch Fakten. Differenzierung und eine genaue Klärung tun Not, und zwar dann, wenn in einem Atemzug der Umgang mit der Frau in choreographierten Vergewaltigungsszenen, Geschlechterstereotype im überlieferten Ballettkanon, pornografisch anmutende Fotografien von Bewegungen und der Mangel an Choreographinnen in Leitungspositionen genannt werden. Gerade die im klassischen, modernen und zeitgenössischen Ballett ästhetisch produzierten Körperbilder sollten niemals mit dem realen Körper der Angestellten als dessen Arbeitsinstrument am Theater gleichgesetzt werden. Die Hingabe der Tänzerinnen an Bewegungskreationen gleich welcher Art – auch wenn es sich um die Darstellung von Vergewaltigungen handelt – fällt grundsätzlich in die Schublade Kunst! Und wer plötzlich fragt, ob der weibliche Körper nicht entwürdigend benutzt werde, übernimmt keine Verantwortung für den Voyeur in dessen eigenem Innern. Hier hilft übrigens der Zeitgenössische Tanz: Im Gegensatz zum sublimen, in Märchen und Todesreiche verdrängten Umgang mit dem Begehren im Ballett, verhandelt er Sehnsucht und Wollust offen, frivol, analytisch und grenzüberschreitend.
Es scheint, als ob der Blick geklärt werden muss dafür, was sich in den Kulissen der nach außen hin abgeschotteten Welt abspielt. Aus dem Blick gerät, wie dort gerade miteinander gearbeitet wird. Wer die Chance hat, dort oft zugegen zu sein, erlebt, wie Tänzerinnen und Tänzer, Choreographinnen und Choreographen sich sehr genau und respektvoll im gemeinsamen künstlerischen Prozess bewegen. Die Atmosphäre ist, wo immer man war, von Achtsamkeit und hoher Wertschätzung füreinander geprägt – gerade weil mit dem Körper und der Empfindungswelt der und des Anderen gearbeitet wird, dieser berührt, gehoben, getragen und umarmt wird. Verstärkend kommt hinzu, dass viele Tänzerinnen und Tänzer ihr Elternhaus in sehr jungen Jahren für ihren Traumberuf verlassen und zudem meistens in international besetzten Teams arbeiten. Ein besseres Training für gegenseitige Toleranz und Wahrung von Grenzen gibt es kaum. Tief scheint auch im positiven Sinne die gegenseitige Abhängigkeit voneinander im Bewusstsein verankert zu sein. Jede und jeder braucht Aura und Fähigkeiten der und des anderen, um die gemeinsame Leidenschaft leben zu können. Das Bestreben, sein Bestes für die Compagnie oder die jeweilige Kreation zu geben, auch um legitimerweise selbst voranzukommen, fließen in diese besonderen Arbeitsatmosphären ein. Das hat nichts mit finanziellen Abhängigkeiten zu tun, sondern mit Ethos und freier Lebensentscheidung. Die vielfältige Produktion von Tanzkunst hätte unter anderen als diesen Umständen kaum Chancen.
Wegweisend an der aktuellen #metoo-Debatte im Tanz ist meines Erachtens ein anderer Punkt: Dem Diskurs über Geschlechterungerechtigkeit, was die Höhe von Honoraren und die Verteilung von Leitungspositionen anbelangt, ist endlich wieder Raum gegeben. Der Mangel an Choreographinnen, die von ihrer Arbeit leben können, die Einfluss auf die zeitgenössische Ästhetik haben und anerkannte Alternativen zu vorherrschend männlichen Bewegungssignaturen liefern, ist auch in Deutschland nicht übersehbar. Trotz langjährigem Wirken von einigen Frauen als Ballett- oder Tanztheaterdirektorinnen hat die weibliche Interpretation der Welt mit den Mitteln des Tanzes heute kaum Spuren im kollektiven künstlerischen Bewusstsein hinterlassen – mit Ausnahme von Pina Bausch und den Frauen in ihrem legednären Ensemble.
Das ist im 21. Jahrhundert schlicht nicht hinnehmbar – vom Verschwinden der kreativen Mütter ganz zu schweigen. Vielleicht wäre das mal einen Hashtag wert.
Kommentatorin: Alexandra Karabelas, erschienen in der April-Ausgabe DIE DEUTSCHE BÜHNE
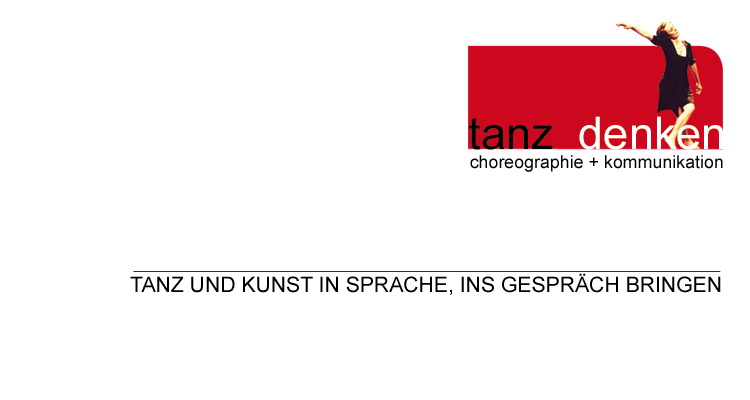



Neueste Kommentare