Es ist so eine Sache mit dem freien zeitgenössischen Tanz: Viele tummeln sich dort, und viele können auch gut tanzen. International geschult in der Bewegungserzeugung gleiten seine Könner pfeilschnell, jede Form nur passierend und meist in Alltagsklamotten, über den Tanzboden. Zwischendurch wird regungslos oder poetisch geschaut. Gefühle sind entsorgt, und wenn sie vorkommen, dann werden diese entweder zitiert oder herausgeschrien. Gelacht wird selten.
„Research im Kollektiv“ heißen im freien Zeitgenössischen Tanz seit vielen Jahren zudem die Zauberwörter. Dabei wählen sich die Tänzer und Choreographen gemeinsam ein Thema, erhalten daraufhin von aktuell sein wollenden Jurys Fördergelder. Los geht das Sammeln von Gedanken und Ideen, Bewegungen werden ausprobiert, die gewonnenen Szenen und Erkenntnisse zu einem Abend zusammengestellt. Der freie Künstler, der mit seinem Werk alleine von seinem Weltempfinden erzählt, stirbt daneben, ohne dass es einer merkt.
„Research“-Choreographien spiegeln hingegen im besten Fall einen Befund der Wirklichkeit. Sie wecken Empathie oder klären auf. Gefühle werden entweder zitiert oder existieren nicht. Zugemutet wird oft wenig. Was sich die Choreographen und Tänzer vom Publikum an zu Lernendem wünschen steht schließlich im Programmzettel. So auch am Freitagabend. Sei mutig, so zu leben, als ob es kein Morgen gäbe, steht da. Das Problem ist nur: Was ist, wenn die so entstandene Aufführung intelligenter ist als ihre Hersteller? Wenn die Aufführung wohin will, wo sie aber gar nicht hin darf? – Das ist, könnte man sagen, im FELINA-Areal den Choreographen Amelia Eisen, Mike Planz und Kirill Berezovski mit ihrem unpassend betitelten Stück „Winterschlaf“ passiert.
Jeder von ihnen trat zunächst mit einem Tänzer an, und danach choreographierte jeder für alle Tänzer, das waren die wunderbare Rebecca Häusler aus Mannheim, Ayesha Katz aus Australien und Pascal Sangl, ebenfalls in Mannheim lebend. Ihr Thema: die heutige Erfahrung von Zeit im immer selben Mantra der Schnelllebigkeit der einen und der Langsamkeit der Abgehängten. Die Ankündigung verspricht also auch soziale Sprengkraft. Das sieht man aber nur nicht. Stattdessen ist ein Stillleben aus Sofa, Lampe und Tischchen zu sehen. Sangl sitzt da und liest im Smartphone-Zeitalter tatsächlich ein Buch. Häussler wandert brav imaginäre Räume ab, vollzieht Alltagsbewegungen wie Zähneputzen, Wimpern tuschen, Lippen nachziehen und kocht Espresso, den sie dann auch trinkt. Gut situierte Mittelstandskinder bei der künstlerischen Arbeit? – Man möchte dort, in diesem hyperrealistischen, altmodischen Raum dennoch bleiben. Die Ruhe der Menschen und dieser Szenerie genießen. Das Langsame. Die Intimität. Seiner eigenen Saturiertheit begegnen. Das macht etwas mit einem.
Anstatt hier weiterzumachen, haben sich die Künstler aber anders entschieden. Katz prescht als Irgendwer mit besagten zeitgenössischen Bewegungsflüssen in die Szene, rollt und schleudert sich über den Boden, dass ihre Haare wippen. Dann sagt Sangl auf englisch wie ein Dichter, dass wir nur die Zeit haben, was nicht stimmt, da wir nur unseren Körper haben und den Atem. Darüber aber wird vor lauter Intellektualität hinweg geschaut. Wie einen losen Faden lassen die Tänzer fortan den einzigen, zauberhaften Moment ungenutzt sausen. Sie füllen die folgende Stunde mit nichtssagenden Bewegungsflüssen, die sie natürlich im Tempo unterschiedlich gestalten um unterschiedliches Zeitempfinden erfahrbar zu machen. Oder sie kreieren Momente in denen veranschaulicht wird, dass Zeit nicht existiert sondern das Vorherige im Jetzt und das Jetzt im Vorherigen. Das alles irgendwie komplex, abstrakt, aber das war es dann auch. Zum Schluss zupft sich Häussler wieder die Wimpern. Als ob nichts war. Die Zeit steht still und ist doch vergangen.
Autorin: Alexandra Karabelas, erschienen in der Rheinpfalz.
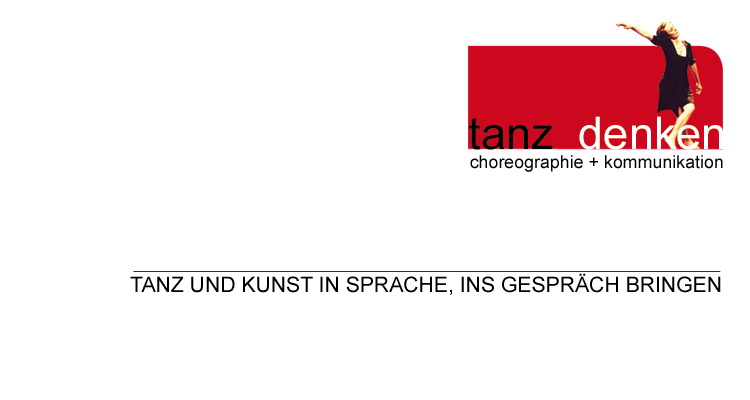

Neueste Kommentare