Silbriges Top, weißer Hosenanzug, ein paar lange Ketten um den Hals, bauchfrei und barfuß, die langen roten Haare offen – Alex Mayr empfing ihr Konzertpublikum Samstagabend auf der Seebühne im Luisenpark selbstbewusst und mit Stil. Dennoch war sie aufgeregt. Dass sie, ihre Bandmitglieder Konrad Henkelüdeke, Sebastian Brödner, Konstantin Gropper, Jochen Welsch und Stefan Udri sowie ein großer Haufen an auf Abstand sitzenden Zuhörer ihr Konzert anlässlich der Veröffentlichung ihres zweiten Albums mit dem schlichten Titel „Park“ genießen konnten, nach Monaten in Lock-Downs, ohne jede Perspektive, das sei fast zum Heulen schön, so Mayr gleich nach dem zweiten Song mit dem Titel „Alle“: „Dieses Live, das hier, das hat gefehlt“.
Einiges ist bereits über Alex Mayr geschrieben worden. Über Ihren musikalischen Werdegang als Tochter eines Musiklehrers und Leiters der Theater- und Musicalarbeit, über den Aufbau ihrer künstlerischen Kollaborationen, das große Talent und Potenzial der Wahl-Mannheimerin mit akademischem Abschluss von der Popakademie sowie ihren Stil, den sie selbst „Soundtrackpop“ nennt. Auch im Netz kann man die Sängerin in ihren dort hinterlegten Musikvideos mit ihrer Kunst in Augenschein nehmen.
Wer Alex Mayr dann mit den Kollegen an den Drums, den Bläsern und den Gitarren erlebt, den berührt vor allem, wie viel sie von sich als Künstlerin und als sehr dankbarer Mensch trotz der immensen Schwierigkeiten, die Corona allen Künstlern beschert hat, sichtbar werden lässt. Recht hat sie, denkt man, als sie einem etwa den Satz zukommen lässt: „Hey, einfach mal einen Song schreiben ist manchmal besser als in Therapie zu gehen“ – auch wenn, auch das wird spürbar an diesem Abend, die Musik ein anspruchsvoller Lebenspartner ist. Musik gibt und sie zehrt. Nach dem Satz greift Mayr für „Krocket“, „einer meiner emotionalsten Songs“, in die Tasten. Die hohen Töne, die sie dem Keyboard entlockt, klingen wie jene einer Spieluhr, die sich in den Wind schreiben. Es ist ein Song über die Eltern, die Geborgenheit in der Kindheit und die Sehnsucht danach, wie Mayr überhaupt in ihren oft melancholischen Texten die Kategorie der Zeit bearbeitet.
Das, was Mayr als Künstlerin aber definiert, zeigt sich wenige Sekunden später, als Drums und Bass wie eine Art musikalisches Flussbett formen, über dem Mayrs ruhige, klare und leicht angeraute Stimme Worte schweben lässt, die in der eigenen Fantasie einem Schmetterlingsschwarm gleichen. Es ist diese Fähigkeit von Mayr, die am stärksten beeindruckt: mit Musik ganze Räume und mit Komposition ganze Landschaften entstehen lassen zu können. In Summe spiegeln alle Songs dieses Abends eine virtuose Bandbreite an kompositorischen Architekturen, die ungeheuer fasziniert. Denn nicht Rhythmus und Emotionen treiben Mayrs Lieder voran, auch wenn das Beobachten von sich selbst und der Welt Anfang und Grundbedingung ihrer Kunst bilden, sondern vielmehr dramaturgisch durchdachtes Entwerfen, Komponieren und Aufbauen dynamischer Flächen, Ecken und Ereignissen aus Rhythmus, Klang und Sound. Man kann, um es gleich zu sagen, nicht zu, sondern im Geiste in Mayrs Songs tanzen weil sie einem Platz dafür lassen. Man kann auf ihnen reiten wie auf einem Pferd, mit ihnen spielen wie ein Delfin im Wasser. Man kann in ihnen still sitzen oder sich von ihnen umspülen lassen. Elf Songs präsentiert Mayr mit ihrer Band an diesem Abend, jeder einzelne ein kleines Kunstwerk und am Schönsten wenn sich die Bläser wie in einer Big Band erheben und alles majestätisch groß werden lassen oder Henkelüdeke sein Schlagzeug erwachen lässt wie in „Ohrfeige“.
Spätestens da waren die Hände oben, man hielt die Augen geschlossen. Davor begeisterte „Geisterbahn“, spielt Mayr in ihm musikalisch doch mit allen Motiven, die man mit einer Geisterbahn verbindet. Zum Schluss erhebt sie ihre Stimme, wird hell, hohl, und großartig unheimlich. Nachdenklich macht noch, dass Mayr Zeit braucht, um mit ihrem Gesang auf Augenhöhe zu ihren Kompositionen zu kommen. Am Anfang noch sehr damit beschäftigt, die Aufregung, das Singen, das Greifen in die Saiten der eigenen E-Gitarre und das Keyboard unter einen Hut zu bringen, ist sie mit ihrem Gesang noch nicht vorne, sondern setzt die Worte zu schwach oder von zu weit weg in die selbst geschaffenen Räume, in denen sie dann versinken, obwohl ihre Texte immer etwas zu sagen haben. Erst im letzten Drittel des Konzerts und vor allem dann, wenn sie nicht selbst die Instrumente spielt, befinden sich Musiker und Sängerin im Gleichgewicht. Was für ein Genuss.
Autorin: Alexandra Karabelas, erschienen in der Rheinpfalz 2.8.2021, Foto: Sarah Ungan.
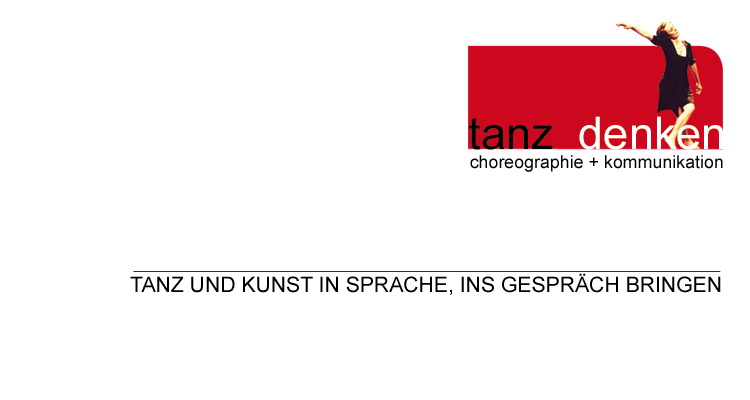

Neueste Kommentare