Noch Tage nach dem Erlebnis von „The Great Tamer“ hallt die immerfort erklungene Melodie aus Johann Strauß berühmtem Wiener Walzer „An der schönen blauen Donau“ nach. Sanft wie Wellen hatten die berühmt gewordenen Klänge die ausdrucksstarken und doch so verrätselten Tableaux vivants umspült, die Dimitris Papaioannou 2017 dem Zuschauer knapp zwei Stunden lang im Ludwigshafener Pfalzbau praktisch vor den Leib geschoben hatte. Die Bühne: ein bis auf die Seiten- und Hinterbühnen aufgerissener Schlund, aus dem sich, wie eine Zunge, die mächtige, aus grauen Platten aufgebaute Spielfläche dem Betrachter entgegen reckte; oder: eine unwirtliche Gegend, einer Mondlandschaft gar gleich, wenn ein, dann zwei schwer atmende Astronauten die kahle Szenerie betreten. Auch als ein überdimensionales Stück grauer, verschuppter Haut lässt sich das trostlos wirkende Plateau fantasieren, gleich einem nur scheinbar unbewegten Rücken eines Riesenwesens, das sich sogleich erheben würde. Aus seiner Tiefe werden am Ende Menschen geboren. Immer wieder knien die DarstellerInnen, graben oder reißen Löcher auf und hieven Körperteile nach oben: ein Arm, ein Bein, ein schöner Jüngling gar, Paris oder Narziss. Er darf sich unter jene Brust legen, die sich entblößt als sich zeigt, dass der Astronaut, dessen Raumanzug sich öffnet, eine Frau war. Gaia, Mutter Erde, also doch, zunächst überblendet im Bild der genannten Mondlandschaft als sich plötzlich aufdrängende Metapher des Weiblichen – es sind solche überraschenden Wendungen im surrealen, betörenden Lauf der Bilder, die Papaioannous gigantisches Kunstwerk ausmachen.
Sein derzeit große Aufmerksamkeit auf sich ziehendes, performatives Theater setzt vor allem, wie deutlich wird, auf eines: das Bild, den Handlungsvollzug und die Unendlichkeit des Raumes. Eine Erzählung gibt es keine beziehungsweise ‚nur‘ jene Megaerzählung von der vergänglichen Leiblichkeit des Menschen. Der Mensch als auf die Erde Geworfener, als im Dasein Begriffener, nicht im Sosein, wollte man auf Heidegger zurückgreifen, steht bei Papaioannous außergewöhnlicher Kreation im Mittelpunkt. Das zeigt bereits der Beginn des Werks. Ein Mann, dessen Schuhe mit der Erde verwachsen sind, muss aus diesen heraustreten. Er geht zu einem Schemel, zieht sich aus, und wandert zu einer weiteren Stelle im Raum, wo er eine der Platten umdreht und sich wie ein zu sezierender Leichnam nackt niederlegt. Ein zweiter Mann kommt und bedeckt ihn mit einer weißen Folie. Ein dritter kommt. Er beugt sich, nimmt eine Platte vom Boden und lässt diese so neben dem liegenden Mann fallen, dass ein kleiner Wind entsteht und die Folie aufwirbelt. Der nackte Mann steht auf. Dieser auch schmunzeln lassende Reigen vom Anziehen, Ausziehen, Hinlegen, bedeckt werden und Entblößen wird an die fünf, sechs Mal vollzogen. Irgendwann zählt man nicht mehr mit. Fast tranceartig kippt man in die sich ausdehnende klare Energie dieses großartigen Gesamtkunstwerks.
Eine Frau im langen Gewand mit einem Blumentopf auf dem Kopf, aus dem Pflanzen ragen, schiebt sich dann ins Bild – Anselm Kiefers „Frauen in der Antike“ könnten hier Pate gestanden haben, aber auch Artemis, allerdings ohne Bogen.

Zur Freude der ZuschauerInnen erklimmt dann eine Art weiblicher Kentaur das Gelände – eine Darstellerin erhebt ihren nackten Oberkörper über zwei rückwärts krabbelnde Kollegen, deren Beine so kunstvoll schwarz bedeckt sind, dass sich ein Mischwesen auf überdimensionalen, muskelstarken Beinen ergibt.
Seine gigantische Eigentümlichkeit erfährt dieses berauschende Kunstwerk in seinem speziellen Rückgriff auf die griechische Mythologie, insbesondere auf die Erzählung der Titanen, als jene Kinder Gaias, die im Goldenen Zeitalter herrschten und am Ende infolge eines Kampfes in der Unterwelt landeten. Atlas stand Pate in dem berückenden Bild, die Welt wie einen Spielball auf den Schultern zu tragen. Der Kurzschluss mit der Welt der Renaissance darf nicht fehlen. Lustvoll inszeniert Papaioannou à la Hieronymus Bosch Begegnungen mit dem Fleisch des Menschen und sei es nach einer wüsten Obduktion als Festmahl am Tisch.
In dem knapp zwei Stunden dauernden Tanztheater de luxe fällt kein Wort. Es wird kein Film gezeigt. Keine Videoprojektion. Kein Lied erklingt aus dem Mund jener, die sich auf der Bühne zeigen. Papaioannou setzt ganz auf die körperliche, figurative Präsenz der DarstellerInnen. Seine Männer in schwarzen Anzügen und die Frauen mit offenem Haar bilden eine gelassene Reminiszenz an das stilprägende Tanztheater von Pina Bausch. Wo diese aber tanzen ließ, ‚was bewegte‘, so eines ihrer geflügelten Worte, berauscht Papaioannou als bildender Künstler, der den Tanz hinter dessen erlebbarer Grenze wirken lässt. Dort, wo auch der Tanz nicht mehr spricht.
Autorin: Alexandra Karabelas, erschienen am 14.11.2018 auf tanznetz.de
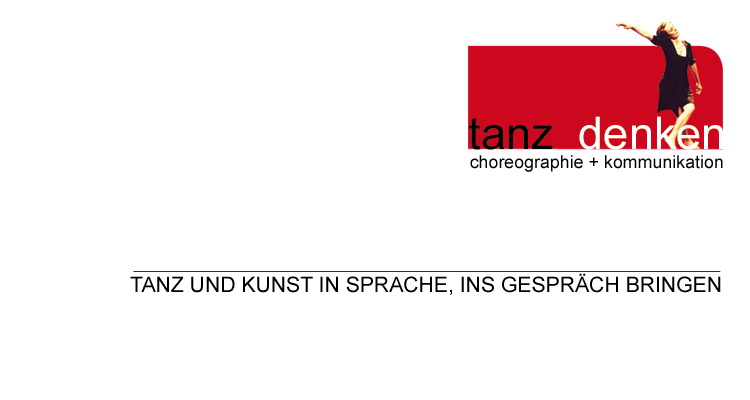

Neueste Kommentare