Wie eine leere Festung steht sie derzeit da: Die Kunsthalle Mannheim. Normalerweise wäre jetzt Hochbetrieb. Längst hätte die neue Anselm Kiefer-Ausstellung in ihren Bann gezogen. Seit knapp drei Monaten aber ist das Haus für Besucher aus Gründen der Pandemie geschlossen. Kiefers großformatige Gemälde und raumgreifenden Skulpturen aus der Sammlung Hans Grothe verharren ungesehen im Erdgeschoss im Wartezustand. Ebenso die zahlreichen Werke der Sammlung.

Es fehlen die Blicke auf sie. Auf Kiefers schroffe, aus Farben, Metallen und Naturmaterialien geschichteten, mythologisch aufgeladenen Gemälde, in die sich oft, wie in einer Collage, Worte hineingezwängt haben. Es fehlen Augenpaare. Jene, die sich heben, während sie den Stufen aus den metallenen Bettgestellen in der Installation „O.T. (Inferno)“ von Rebecca Horn nach oben folgen, oder die blinzeln, wenn sie James Turells beeindruckender Lichtinstallation „Split Decision“ gewahr werden. Es fehlen auch Momente, in denen sich jemand vor Überraschung duckt, weil er hoch über sich die wie auf einer Umlaufbahn schwingende Uhr in Alicja Kwades Installation “Die unbewegte Leere des Moments“ im Atrium der Kunsthalle erblickt hat.
Doch auch wenn die Uhr noch tickt, hängt sie aktuell regungslos an ihrer Kette nach unten und misst die langsam vergehende Zeit und bei Turell ist das Licht aus. Der Dunkelheit und Leere entsprechen eine neue Stille und Stummheit in der Kunsthalle Mannheim. Denn es fehlt auch das vielstimmige, informative, und die Gedanken und Gefühle formende Sprechen über die Kunst, die vielen zum Lebensinhalt geworden ist. Ist die Kunsthalle normalerweise ein Ort der gelebten Begegnung zwischen Mensch und Kunstwerk, ein Ort, an dem sich der Akt der Wahrnehmung unmittelbar vollzieht, mutiert sie im Gehirn ihrer Zeitzeuginnen und Zeitzeugen derzeit zu einem einsamen Ort im eigenen Gedächtnis; zu einer Art immateriellem Erbe in Gedanken, über das man aber nicht spricht weil man sowieso keinen trifft.
Keiner kann davon stärker ein Lied singen als Kunstvermittlerinnen. Seit über dreissig Jahren arbeitet Andrea Schmidt-Niemeyer in der Kunsthalle. Sie sagt: „Ich finde es bitter, dass die Arbeit der Kuratorinnen und Kuratoren für die Kiefer-Ausstellung nun monatelang verschlossen bleibt.“ Am 29. Oktober 2020 hatte sie ihre letzte Führung. Ihre Kollegin Andrea Ostermeyer aus Mannheim hatte die Kunsthalle zuletzt am 17. Oktober um 15:30 Uhr betreten, Mareile Martin am 1. November. Jede von ihnen hat mehrere Führungen durch die Anselm Kiefer-Ausstellung fertig vorbereitet in Kopf und Computer, Ostermeyer alleine fünf für verschiedene Gruppen. Mitte November sollte es losgehen. Ostermeyer hatte sich seit September gedanklich sehr konzentriert im Themenfeld Kiefer aufgehalten, erzählt sie; intensive drei Wochen hatte Andrea Schmidt-Niemeyer in ihre Kiefer-Führung investiert, auf einem umfangreich vorhandenen Wissen aufbauend. „Manchmal braucht es viele Lebensjahre, um das Werk eines Künstlers oder einer Künstlerin in seiner Bedeutungstiefe zu verstehen“, meint Martin, der die unvergleichlich freie und geistig anregende Atmosphäre in der Kunsthalle sehr fehle.


Alle drei zieht es in Gedanken oft in die Kunsthalle, Martin sagt, sogar manchmal in Träumen. Ostermeyer beschreibt es so: „Mein Hunger wird mit jeder Woche größer, und im Verhältnis dazu wird auch meine Erinnerung an bestimmte Werke intensiver. Ich vermisse es, die Atmosphäre im Bild von Jean-Baptiste-Camille Corot zu sehen und die Rottöne bei Eugène Delacroix. John Bock beschäftigt mich innerlich, da Kubus 4 in seiner Inszenierung fantastisch aufgebaut ist. Und natürlich fehlt mir William Kentridge mit seinem dröhnenden Werk einer raumgreifenden Video-Installation. Überraschenderweise schiebt sich auch die im Oktober eröffnete Sonderausstellung „Grenzenlos“ vor mein geistiges Auge, da ich so gerne durch die dort gezeigten Künstlerbücher von Michael Buthe blättern würde.“ Es seien Reisen für die Augen, die derzeit nicht unternommen werden könnten, gepaart mit Gesprächen mit anderen Menschen, beschreibt Andrea Schmidt-Niemeyer ihren derzeitigen Mangel. Sie kann die pandemiebedingte Schließung nachvollziehen, doch spürt sie auch Wut: „Kultur macht unsere Gesellschaft zu dem humanen Ort, den wir schätzen. Verlieren wir die Kultur, wie zurzeit, verlieren wir ein hohes Maß an Lebensqualität. Ich will in keiner Gesellschaft leben, in der es nur darum geht, was Profit bringt.“ Andrea Ostermeyer spürt für sich die Erkenntnis, dass kein Instagram, keine sozialen Medien das Raumerlebnis und das Erlebnis des Betrachtens wettmachen könne. Das Gespräch in der Gruppe sei dann, so Martin ergänzend, vergleichbar mit einer Geige: „Wie dieses Instrument braucht die Kunst einen Resonanzboden, damit Klang entstehen kann.“
Autorin: Alexandra Karabelas. Der Text erschien am 01.02.2021 in der Rheinpfalz. Foto Beitragsbild: Der fruchtbare Halbmond. Anselm Kiefer.
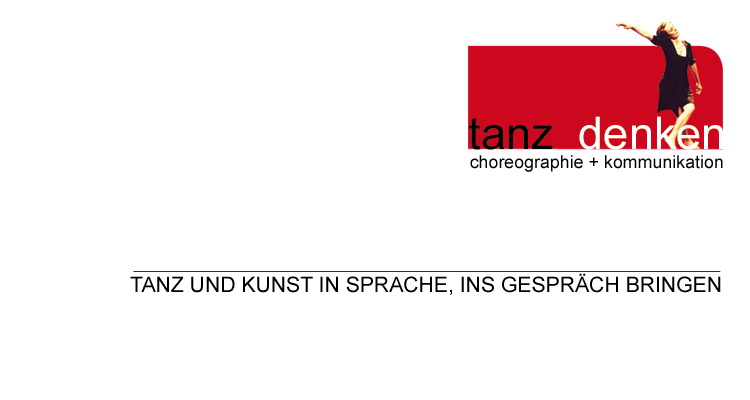

Neueste Kommentare