Was ist Tanz? Und wann erlebt man eine Darstellung? Eine solche Frage impliziert die Behauptung, dass Tanz das Gegenteil von Darstellung ist; es sich also um etwas handelt, was sich von der Form und dem Material abhebt; durch sie bedingt ist, ohne dass sich sein Wesenskern dadurch erklären würde.
Auf wertvolle Weise bot Ende der Spielzeit das Tanzensemble am Theater Regensburg unter Leitung von Yuki Mori jetzt die Gelegenheit, diesen Fragen nachzusinnen. In feiner Kooperation mit dem Kunstforum Ostdeutsche Galerie übertrug es den Abend „Heimat“ mit Kurzchoreografien der Tänzer in die Räume des Museums am Rand des Stadtparks. Dort sind aktuell fotografische Arbeiten von dreizehn Künstlern zu sehen, die sich ebenfalls mit dem Thema der Heimat auseinandersetzen. Die meisten präsentieren sich, oft ausgehend von der eigenen Biografie, als ihr Sucher. Behandelt werden Fragen die Inhalt verlangen: Was ist Heimat? Wie sieht sie landschaftlich aus? Wie familiär? – Schön hierbei, dass sich kaum eine der choreografischen Arbeiten direkt auf ein fotografisches Werk bezog. Nicht nur war der Tanz dadurch von Anfang an bezüglich seines Inhalts und seiner Aussagekraft eigenständig und es oblag dem Betrachter, Bewegung und Bild, Form und Fotografien einander näher zu rücken; auch sein Potenzial, die stillen Museumsräume mit Vitalität und Leben zu erfüllen und das im Moment der Aufführung sichtbar und erlebbar zu machen, was Göran Gnaudschun am Bild interessiert, trat deutlich hervor: dass es sich um eine permanente Gegenwart handelt, die nur durch den Betrachter Vergangenheit und Zukunft erfährt. Fernab der Bühne schuf das Tanzensemble des Theaters Regensburg so imaginativ Wertvolles wie Präsenz, Gegenwart und Transformation. Materiell bleibt hier nichts zurück ausser der Erinnerung an die Szenen und Bewegungen und die Freude an den erlebten Momenten, pathetisch gesagt: an den Ausdruck von Leben. In krassem Gegensatz steht hierzu die Funktionsweise des Museums mit seinen Ausstellungen: Steht man Tage später wieder in der Ausstellung, blickt man, vom Standpunkt des Tanzes, auf Namen und Gesichter von Menschen, die nicht da sind; auf Konzepte von Heimat, die von hier aus fern ist und mit der eigenen nichts zu tun hat; auf das tote Material der Fotografie, das von einem Moment erlebter Gegenwart erzählt, die längst Vergangenheit ist. Allein im Inneren des Betrachters wird dieses wieder in den Augenblick gehoben, während man von Raum zu Raum schlendert. Im Gegensatz zu dazu hatte das Tanzensemble den Raumweg der Besucher festgelegt, was die Aufführung zu einem kurzweiligen, intensiven Vergnügen werden ließ. Die sieben, für den neuen Ort überarbeiteten beziehungsweise neu gestalteten Kurzstücke verteilte es auf Räume verteilt als Parcours, den die Besucher gegenläufig in zwei Gruppen durchschritten. Der Tanz musste sich sein passierendes Publikum auf diese Weise nicht, wie sonst bei ganz offenen Formen, erst mühsam erobern, sondern stand von Anfang an im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Den gemeinsamen Auftakt für beide Besucherstrecken gestaltete der Taiko-Spieler Leonard Eto. Im schmucken Langrock, kleine Becken in der Hand, schritt er im Foyer wie ein Priester in die Mitte, wo er seine Gemeinde auf das Kommende vorbereitete. Die beeindruckend starke Energie, die dieser Künstler auszutrahlen wusste, war insofern ein wenig verschenkt, als sich scheinbar keiner um eine intensivere choreografische Bearbeitung seines Auftritts gekümmert hatte. Ähnlich intensiv und leider ebenso wenig konsequent zu Ende geführt das Solo „Birth“ von Alessio Burani und Riccardo Zandonà. Zugegeben: Wunderschön anzusehen war Bourani als splitternacktes Häuflein Mensch am Boden im kleinen Durchgangsraum, vor dessen Glastür man sich duckte , um so viel wie möglich von dem Ereignis mitzubekommen. Allein dieser Akt in Regensburg verdiente Respekt. Mutig und behutsam schenkte dieser Tänzer seinem Publikum die seltene Gelegenheit, den Körper als Träger und Produzent von Tanz, als Material aus Seele, Muskeln, Herz, Haut und Knochen ansehen zu dürfen. Björks „All is full of love“ wäre hier gar nicht mehr nötig gewesen, dafür mehr Aufmerksamkeit auf der inneren Dramaturgie der Bewegungsfolge, die so viele Assoziationen evozierte, dass sie kaum mehr in eine innere Struktur oder auf einen Punkt hin zu konzentrieren waren: Warum verfällt der Mensch nach seiner zarten, liebevollen Geburt in krampfartige Bewegungen? Steht er doch in Bezug zur Golem-Thematik, die im Raum davor behandelt wurde? Oder zum symbolischen Gehalt von Dorota Nieznalskas Dornenkrone, die in nächster Nähe zu ihm lag? Welche Interpretation der Welt will der Tänzer mir hier zeichnen?
Ein weiterer, spannender Moment erfolgte danach. Burani öffnete die Türen, forderte sein Publikum auf, mitzukommen, ging in den nächsten Raum, zog sich an und verschwand in der Unscheinbarkeit der Rolle des Museumsbesuchers. Als zweiten Coup tanzte er in Pauline Torzuolis Schauskelstuhl-Pas de Trois „Adossé“, der in den Museumsräumen im Gegensatz zur Darstellung auf der Bühne an Spannung und Dichte gewann. Dies lag an der Helligkeit, aber vor allem am ungewöhnlichen Blickwinkel auf das Stück. Befand man sich mit der Solistin gemeinsam im Raum, spielte sich das Duett im Raum daneben ab. Nie sah man alles, auch wenn sich alles gleichzeitig abspielte und aufeinander zu beziehen war: Tanzt das Duett die Vergangenheit oder die Gegenwart der Solistin? Oder verhält es sich anders herum?
Erneut als Choreograf erwies sich Burani dann vom dritten Part des Parcours im großen Saal. Tatsächlich tanzte das gesamte Ensemlbe – auch das ein Novum in Regensburg. Betörend wie man den Tänzern gegenüber stand. Zuschauer und Tänzer auf einer Ebene. Körper betrachten Körper. Besucher nehmen sich still ganz offen wahr. Das funktionale Konzept von Museum als Haus, in das man geht, um Objekte anzusehen, wird hier gesprengt, weil sich der lebendige Körper dazwischen drängt. So gesehen hätte es der impulsiven, nervös-dynamischen Choreografie gar nicht mehr bedurft, die Leonard Eto mit Trommelschlägen initiierte. Andererseits gerieten die Tänzer dadurch so sehr außer Atem, dass ihr Schnaufen sich durch die besondere Akkustik im Raum vervielfältigte und sich das Geräusch des Atems als Höhepunkt oder das eigentliche Werk generieren ließ, als Symbol dafür, dass über der Frage nach der Heimat die Frage nach dem Sein steht. Locker spielten im Anschluss die bereits bei der Uraufführung gelobte Ljuba Avvakumova und Ina Brütting auf, die mit den Mitteln des Tanztheaters – mit Sprache, Objekten und dem alltäglichen Akt des Wäscheaufhängens – die Frage nach der eigenen Heimat direkt thematisierten. Wundersam auch hier der Moment der Transformation: Avvakumova und Brütting beziehen sich sprachlich auf einer der Fotografien, drehen zauberhafte Kreise und stehen dann direkt vor einem. Die Grenzen zwischen Performer und Zuschauern lösen sich auch hier auf. Nach einem melancholisch-heiteren Zwischenspiel von Pauline Torzuoli und Yuki Moriauf einer Bank, das noch am ehesten dem klassischen Präsentationsrahmen von Theater entsprach, endete dieser Parcours filmisch und mit einer schönen Provokation. Minutenlang sitzen Andrea Vallescar und Claudio Costantino am Boden an der Wand und tun nichts. Auch darin liegt die Macht des Tänzers. Sich nicht zu bewegen wenn man wegen ihm gekommen ist. Stattdessen bekommt man einen Film zu sehen, in dem sie das hin und her eines Liebespaars, die Diskussionen über das „Ja“, „Nein“ und „Wie weiter“ in packenden, kleinteiligen und knapp ausgeführten Bewegungen irgendwo am Donauufer platziert tanzen. Zu zweit Sein kann auch eine fragile Heimat auf Zeit sein.
Erschienen am 5.7.2014 auf http://www.accesstodance.de/blog/26503/was-macht-tanz-im-museum
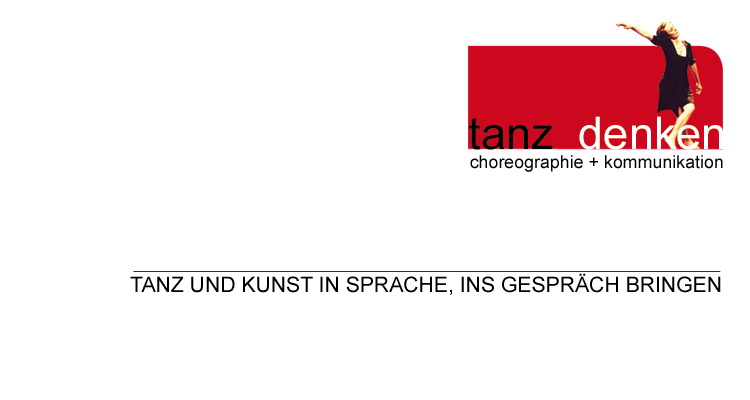

Neueste Kommentare