Douglas Lee und Goyo Montero werfen neue Perspektiven auf Strawinskys „Petruschka“ und „Sacre“ am Staatstheater Nürnberg
Genuss pur am Staatstheater Nürnberg. Ausverkauft auch die vierte Vorstellung des neuen Ballettabends „Strawinsky“ – Grund genug hinzufahren um mit eigenen Augen prüfend zu sehen, worin der Erfolg von Goyo Monteros „Sacre“-Interpretation und Douglas Lees „Petruschka“ liegen könnte. Lee ist dabei nicht das erste Mal in Nürnberg, und, um es gleich zu sagen, Monteros immer zeitgenössischer werdendes und aussehendes Ensemble passt souverän zu der ganz anders gearteten, artifiziellen Formensprache, die Lee in den vergangenen Jahren entwickelt hat.
Monteros Truppe tanzte präzise, kristallklar, athletisch und inneren Linien folgend, dass es eine Freude war, Tanz als Kunstwerk zu erleben. Inhaltlich hatte sich das künstlerische Interesse des in Berlin lebenden Briten insofern weniger auf die Geschichte und Gefühle der in „Petruschka“ vorkommenden Figuren fokussiert – auch wenn diese vollends respektiert und nacherzählt wurde – als vielmehr auf die Frage, wie er die seit über hundert Jahren existierende Erzählung in seiner, in den vergangenen Jahren originär entwickelten, skulptural geprägten Bewegungsästhetik aufscheinen lassen konnte. Gepaart mit seinem zweiten Vergnügen an der Gegenwelt, die Theater kreieren kann, an dem Abseitigen, Untergründigen, Unheimlichen oder aus der Reihe Fallenden, an den Albträumen, die nachts wie Gewächse im Schatten sich in der Fantasie entfalten, tauchte Lee sein „Petruschka“-Ballett über einen Marionettenspieler auf dem Jahrmarkt, dessen drei Figuren Petruschka, die Ballerina und der Mohr sich verselbständigen, miteinander kämpfen und einen Mord zulassen, in ein lichterblinkendes Illussionstheater, an dem man sich kaum satt sehen konnte.
Immer wieder platzierte Lee die Tänzer wie Handpuppen, die lose über Kästen hängen, auf der Bühne; ließ einzelne Köpfe, Beine oder Arme erscheinen. Zum Schluss wähnte man sich wie in einem Keller oder einem Lagerhaus, in dem die Menschenpuppen auf Regalen an der Wand wie Schuhe bei „Snipes“ abgelegt sind. Das Ensemble taucht immer wieder wie ein Heer aus Puppensoldaten auf, das kanonisch in den Raum vordringt. Die parallel ablaufende, mikroskopische Betrachtung von Lees Bewegungsinventionen gerieten schließlich zur wahren Wonne, platziert Lee doch das Port de Bras als offenen Raum im 45-Grad-Winkel vor dem Oberkörper, der mit anderen Körperteilen durchwandert werden kann. Masse, Volumen, Um- und Hohlraum werden zu Kategorien, mit denen plötzlich diese zeitgenösssiche Ballettästhetik à la Douglas Lee neu definiert werden könnte.
Auch Goyo Monteros Ringen um einen eigenen Ansatz für den anschließenden „Sacre“ hat sich gelohnt. Montero, bekannt für seine ehrlichen, zu Welt und Gesellschaft Stellung beziehenden, komplexen Tanzwerke, die sich ohne Scheu auch zunehmend spirituellen Dimensionen öffnen, hatte den Mut, alle Kernelemente des ursprünglichen Mythos beizubehalten – die Menschengruppe, die sich auf die göttliche Welt hin orientiert; ihr Verlangen nach Wohlergehen und der daraus resultierende Mechanismus, sich egoistisch dafür einzusetzen; schließlich das dafür einzulösende Opfer. Jedoch blieb er nicht an diesem Punkt stehen oder ging über diesen gemäß etwa einer postmaterialistischen Denkweise hinweg. Vielmehr reflektierte er das Opfer-Thema sehr genau in Bezug auf das universale Thema des Mitgefühls und spitzte es zudem auf die Geschlechterfrage zu – ein Thema, das er bereits seit gut einem Jahr immer wieder bearbeitet, so etwa in „M“, seinem Männerstück aus der vergangenen Spielzeit. Insofern wird in Monteros „Sacre“ nicht eine junge Frau geopfert, sondern sie opfert sich, damit die anderen Rettung erlangen. Mit dieser Position kreiert der Spanier wiederum eine spannende Gegenposition zur damaligen, kühnen Darlegung durch Bausch, hatte doch deren „Sacre“ der Verherrlichung des männlichen Eros, wie es bis dato einige Regisseure unternommen hatten, konsequent die Realität der Auswahl, Aussonderung und Tötung einer Frau entgegen gesetzt.
Und so erblickt man in Monteros „Sacre“ das Ensemble in roten, wie mit Dreck besudelten Hosen und Oberteilen, kreiert von Angelo Alberto, auf dem Boden sitzend. Ein hungriges Kollektiv wie in einer Arena, die von hochgezogenen Tanzteppich-Planen begrenzt ist. Es richtet den Blick nach oben, lässt, den ersten Tönen und Klängen folgend, Hände, Arme, Oberkörper und Beine in die Höhe wachsen, kreisen und wieder sinken. Ein überdimensionaler, sich herabsenkender Lichtkreis schwebt wenige Minuten später nach unten. Angst und Erregung kommen auf, vergleichbar der Situation jener Figuren in Lars von Triers „Melancholia“, die am Horizont den die Erde zerstörenden unberechenbaren Riesenplaneten erblicken. Ab diesen Momenten beginnt sich Monteros spannende, getanzte Lehrrede zu entfalten. Die Menschen, die er immer als Meute, als Rotte, als Herde in der Masse mit markig-physischen, fast rohen Bewegungen über die Bühne und in die Musik hineintreibt, die wie ein Schlachtmesser auf die tanzenden Körper hinabzusausen scheint, setzen ihre Hoffnungen auf einen Mann, der sich selbstbewusst aufmacht, das Licht der Heilung zu holen. Stattdessen scheint jedoch nur johlend sein Ego auf. Als er versagt, schlagen die Menschen vor Wut auf ihn ein.
Es ist dann eine Frau, die als einzige Mitgefühl entwickelt und sich um ihn kümmert. Dafür, dass sie, in Lichtstrahlen badend, die Verbindung zum Göttlichen spüren und begreifen darf, lässt Montero sie in seiner Geschichte einen hohen Preis bezahlen. Analog zur Jesus-Geschichte erlebt sie, eine Mater Dolorosa, Hohn und Spott. Kraftlos fällt sie zu Boden, nachdem sie allen ermöglicht hat, sich durch den sich herabsenkenden Kreis springend zu retten. Dem Publikum bleibt nichts anders übrig, als kurz ins Dunkle hinein aufzuschreien.
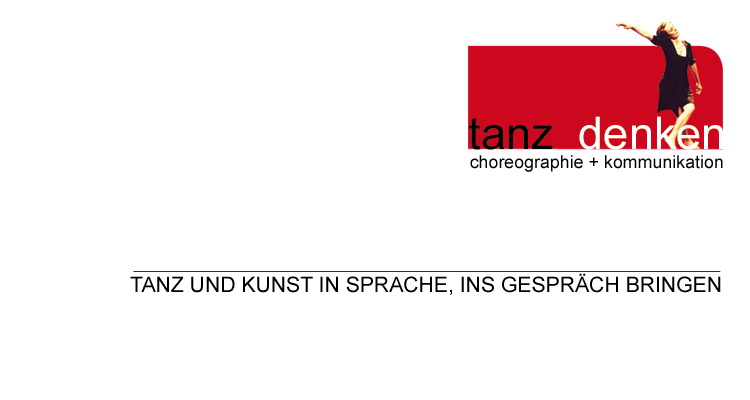




Neueste Kommentare